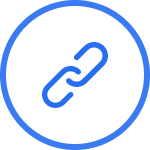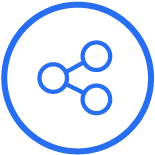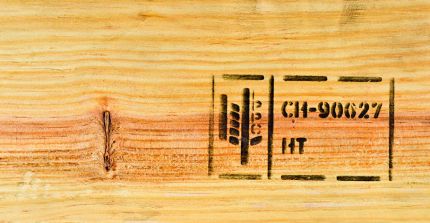„Recycelt“ klingt nachhaltig – aber Rezyklat ist nicht gleich Rezyklat. In der Verpackungsindustrie stoßen Unternehmen regelmäßig auf die Begriffe PRC und PIR, wenn es um Kreislaufwirtschaft und den Einsatz von Kunststoffen mit Recycling-Anteil geht. Für Entscheider:innen ist es relevant zu verstehen, was die Abkürzungen bedeuten, welche Qualitätsunterschiede bestehen und welche Rolle europäische Gesetze spielen. Dieser Beitrag erklärt die Unterschiede, zeigt die Vorteile und Herausforderungen beider Varianten und gibt praxisnahe Tipps für Unternehmen, die ihre Verpackung nachhaltig und gesetzeskonform gestalten wollen.
Was bedeutet PCR? – Post-Consumer Rezyklat
PCR steht für Materialien, die nach dem Gebrauch durch Endverbraucher:innen gesammelt, recycelt und wieder in den Produktionskreislauf eingebracht werden. Beispiele sind Plastikflaschen oder Verpackungen, die nach der Nutzung in der Gelben Tonne landen.
Vorteile von PCR:
- Kreislaufwirtschaft stärken: PCR reduziert den Abfall im Konsumsektor und bringt Materialien zurück in den Wertstoffkreislauf.
- Regulatorisch gefordert: Die EU schreibt explizit PCR-Quoten vor – die Verarbeitung von Post Industrial Abfällen allein reicht nicht, um die Anforderungen der kommenden PPWR zu erfüllen.
- Markenwirkung: Unternehmen, die Rezyklat aus Konsumenten-Abfällen einsetzen, zeigen nach außen eine sichtbare Nachhaltigkeitsleistung – ein Pluspunkt in der Kundenkommunikation.
Herausforderung: Die Qualität von PCR kann schwanken, da Sammelströme und Sortierung nicht immer homogen sind. Aufbereitung und Granulatherstellung sind daher aufwendig und kostenintensiv.
Was bedeutet PIR? – Post-Industrial Rezyklat
PIR bezieht sich auf Abfälle, die bereits während des Produktionsprozesses anfallen – z. B. Verschnitt, Ausschuss oder Überschüsse in der Industrie. Diese Materialien gelangen gar nicht erst zum Endkunden, sondern werden direkt der Kreislaufwirtschaft zurückgeführt.
Vorteile von PIR:
- Konstante Qualität: Produktionsabfälle sind sortenreiner, homogener und leichter wieder in den Prozess einzubringen.
- Kosteneffizient: Da weniger Sortier- und Aufbereitungsschritte nötig sind, ist PIR meist günstiger.
- Technisch stabil: PIR liefert zuverlässige Materialeigenschaften, was es attraktiv für anspruchsvolle Anwendungen wie Klebebänder oder Umreifungsbänder macht.
- Schnelle Wiederverwertung mit vergleichsweise geringem Energieaufwand.
Herausforderung: PIR gilt regulatorisch nur eingeschränkt als „echtes Recycling“. Für viele EU-Quoten zählt PIR nicht oder nur in Teilen.
Der Unterschied in aller Kürze
-
- PCR = Recycling nach dem Konsum
- PIR = Recycling vor dem Konsum (innerhalb der Produktion)
Beide Konzepte leisten einen wertvollen Beitrag zur Ressourcenschonung. Dennoch gilt: Je mehr PCR-Material eingesetzt wird, desto stärker wird die Abfallmenge aus unserem Alltag reduziert – ein zentraler Hebel für nachhaltige Verpackungslösungen.
Hoher PCR-Anteil vs. hoher PIR-Anteil bei Umreifungsbändern –
Ein Vergleich von Qualität und Leistung
Die Materialbeschaffenheit hat Einfluss auf gleich mehrere Aspekte.
Mechanische Eigenschaften:
Ein Umreifungsband muss sich unter anderem in Bezug auf Zugfestigkeit, geringe Dehnung, Wetterfestigkeit und Reißfestigkeit beweisen. Wenn ein hoher PCR-Anteil eingesetzt wird, kann das die Eigenschaften beeinflussen -abhängig davon, wie gut das PCR-Material aufbereitet ist.
Verarbeitbarkeit:
Bandrollen, Verschnitt, Verarbeitung in Maschinen – alles muss stabil laufen. Variierende Qualität kann hier die Produktionsprozesse stören.
Langzeitlagerung / Alterung:
PET-Bänder mit hohem PCR-Anteil könnten eventuell schneller Alterungsprozessen unterliegen (z.B. UV, Feuchtigkeit, thermische Belastung) – je nach Additiven und Aufbereitung. PIR hat hier meist bessere Erfahrungswerte. Der Grund: Kunststoffe durchlaufen beim Gebrauch und bei der Wiederaufbereitung (Waschen, Schreddern, Extrudieren) thermische und mechanische Belastungen. Dadurch sinkt die Kettenlänge der Polymere („Molekulargewicht“), was das Material anfälliger für Versprödung macht. PCR kann unter Umständen auch Fremdstoffe enthalten, sogenannte Additive wie Farbstoffe, Restfeuchtigkeit etc., die die Stabilität beeinflussen. Schwankende Temperaturen wirken sich auf PCR empfindlicher aus, da die Polymerstruktur bereits mehrfach verarbeitet wurde.
Ein Vergleich in Sachen Nachhaltigkeit
Post Industrial Rezyklat und Post Consumer Rezyklat- beides leistet einen wesentlichen Anteil an der Kreislaufwirtschaft. Ein Produkt mit hohem PCR-Anteil kann nachhaltiger sein, wenn die Qualität ausreichend ist, damit es seine Funktion erfüllt, und die Umweltauswirkungen der Verarbeitung / Transporte nicht unverhältnismäßig hoch sind. Ein PIR-dominiertes Produkt kann in manchen Fällen effizienter und damit ökologisch sinnvoller sein – wenn PCR nur durch aufwendige Prozesse und erhebliche Zusatzkosten möglich wäre.
Post Consumer Rezyclat ist besser für die Kreislaufwirtschaft, leistet einen stärkeren Beitrag zur Reduktion von Abfällen, bedeutet damit einhergehend auch oft ein besseres Markenimage, ist oft regulatorisch erwünscht (siehe EU-Regularien und Standards zu Rezyklaten).
Post Industrial Rezyclat ist in der Regel stabiler, vorhersehbarer in der Qualität, oft günstiger und zuverlässiger in technischen Anwendungen.
Reines PCR, reines PIR oder Mischformen?
Kann ein Produkt ausschließlich aus PCR oder aus PIR hergestellt werden? Ja, technisch wäre das möglich. Aber in vielen Fällen werden Mischverhältnisse genutzt, um einerseits Qualitätsanforderungen zu erfüllen und andererseits Umwelt – und Regulierungsziele zu unterstützen. Dabei hängt das Mischverhältnis von mehreren Faktoren ab: Dem Materialtyp (also z.B. PET, PE, PP, PVC… ), der anstrebten Produktleistung und dem Einsatzzweck. Für Kontakt mit Lebensmitteln, technische Verpackungen oder beispielsweise Klebebänder oder Umreifungsbänder gelten besondere Ansprüche an Qualität und Leistung. Die Abwägung, die darüber hinaus getroffen werden muss:
Reine PIR-Produkte sind technisch attraktiv und wirtschaftlich stabil, erfüllen aber häufig nicht die Nachhaltigkeitskommunikation oder die Quotenpflichten moderner Beschaffungspolititk.
Ein Produkt aus 100% PCR ist machbar, erfüllt die geforderten Quoten und ist im Sinne des Markenimage attraktiv. Es funktioniert jedoch nur dann, wenn keine extrem hohen technischen Anforderungen bestehen und der Fokus klar auf Nachhaltigkeit liegt. In der Praxis liegt der PCR-Anteil meist zwischen 30% und 80%, um eine gute Balance zwischen Qualität, Stabilität und gesetzlichen Vorgaben zu erreichen.
EU-Regularien und Standards zu Rezyklaten
Im Einklang mit der politischen Agenda (EU Green Deal, Verpackungsverordnung) und zur Reduzierung des sichtbaren Abfallstroms im Markt werden künftig in EU-Regularien explizit PCR-Quoten verlangt – Post Industrial allein reicht nicht. Die voraussichtlich 2025/2026 in Kraft tretende PPWR schreibt erstmals verbindliche Rezyklatquoten für bestimmte Verpackungen vor, vor allem bei Kunststoffverpackungen. In Entwürfen ist explizit von PCR die Rede, bedeutet: PET-Getränkeflaschen müssen bis 2023 beispielsweise einen Rezyklatanteil von 30% PCR enthalten.
Das heißt: PCR wird regulatorisch höher gewichtet. Setzt ein Hersteller nur Post Industrial Rezyklat ein, erfüllt er gegebenenfalls nicht die zukünftigen Quoten. PIR ist zwar ökologisch sinnvoll (es reduziert den Einsatz von „Neuplastik“ und spart somit Ressourcen ), gilt aber als „internes Recycling“ und entlastet nicht die Konsum-Abfallströme.
Post Consumer und Post Industrial Material – Vergleichstabelle
| Aspekt | PCR (Post-Consumer Recycled) | PIR (Post-Industrial Recycled) |
|---|---|---|
| Definition | Recyclingmaterial, das bereits im Konsumkreislauf war (z. B. Flaschen, Verpackungen, etc.). | Produktionsabfälle, Verschnitt, Ausschuss, Überproduktion – Material, das nie beim Endverbraucher war. |
| Verfügbarkeit & Kontinuität | Oft schwankend, abhängig von Sammelquoten, Aufbereitungskapazität, Sortierqualität. | Meist besser kalkulierbar; industrielle Abfälle sind planbar und gleichmäßiger verfügbar. |
| Qualität / Homogenität | Kann variieren – Sortenreinheit, Verunreinigungen, Alter des Materials, Polymerabbau etc. beeinflussen Materialeigenschaften. | Bessere Kontrolle möglich, da Produktionsbedingungen bekannt sind, wenig Variation, oft bessere Konsistenz. |
| Eigenschaften wie Festigkeit, Verarbeitbarkeit | Potential für Einbußen, je nach Aufbereitung. Z. B. mögliche Schwächung, Färbung, Restfeuchtigkeit, Rückstände von beigemischten Additiven etc. | Tendenziell technisch stabiler, vorhersehbarere Eigenschaften. |
| Kosten | Häufig teurer, aufgrund Aufbereitung, Sortierung, Sammeln, Transporte, Verarbeitung. | Günstiger, da Material schon in der Lieferkette vorhanden ist, weniger Aufbereitungskosten, geringeres Risiko von Fehlanteilen. |
| Umweltauswirkungen / Nachhaltigkeit | Höheres Potenzial zur tatsächlichen Kreislaufwirtschaft: Abfall aus dem Konsum wird reduziert. Signalwirkung, bessere Öko-Performance wenn richtig eingesetzt. | Ebenfalls nachhaltig – weniger neuer Kunststoff, Einsparung von Primärrohstoffen – aber weniger unmittelbarer Einfluss auf Müllreduzierung im Haushalt. |
| Regulatorische & Market Anforderungen | PCR wird in vielen Regularien und in CSR / Nachhaltigkeitszielen höher gewichtet. Hersteller, die PCR einsetzen, können Anforderungen erfüllen, die PIR allein nicht abdecken. | Kann Teil der Lösung sein, aber häufig nicht ausreichend, wenn spezifisch PCR-Quoten gefordert sind. |
Handlungsempfehlung für Unternehmen / Entscheider
- Auf Spezifikationen und Datenblätter bestehen: Materialquelle, Anteil Post Consumer Rezyklat vs. Post Industrial Rezyklat, mechanische Kennzahlen.
- Testen: Materialproben unter realen Verwendungsbedingungen prüfen (Langlebigkeit, Reißfestigkeit, Verarbeitung etc.).
- Kosten vs. Nutzen gegenrechnen: Mehrkosten für PCR können sich lohnen, wenn regulatorische Anforderungen anstehen, Markenimage profitiert, oder Nachhaltigkeitsziele erfüllt werden müssen.
- Markenkommunikation: Transparenz ist wichtig – Verbraucher und Geschäftspartner erwarten Klarheit, was „recycelt“ heißt.
Finden Sie aktuell Angaben wie „recycelt“ und „hergestellt aus Rezyclat“ oder ähnlichem, ist in der Regel von einem hohen Post Industrial Anteil auszugehen. Wird ein Produkt aus überwiegend PCR hergestellt, weisen wir in der Produktbeschreibung darauf hin. So finden Sie beispielsweise bei unseren Folien klimaneutral und 100% recycelt für RAJA Air die Angabe „mit 82% PCR-Anteil“ oder bei unserem Duct Tape Tesa Gewebeband PRO 66462 die Angabe „über 60% PCR“.